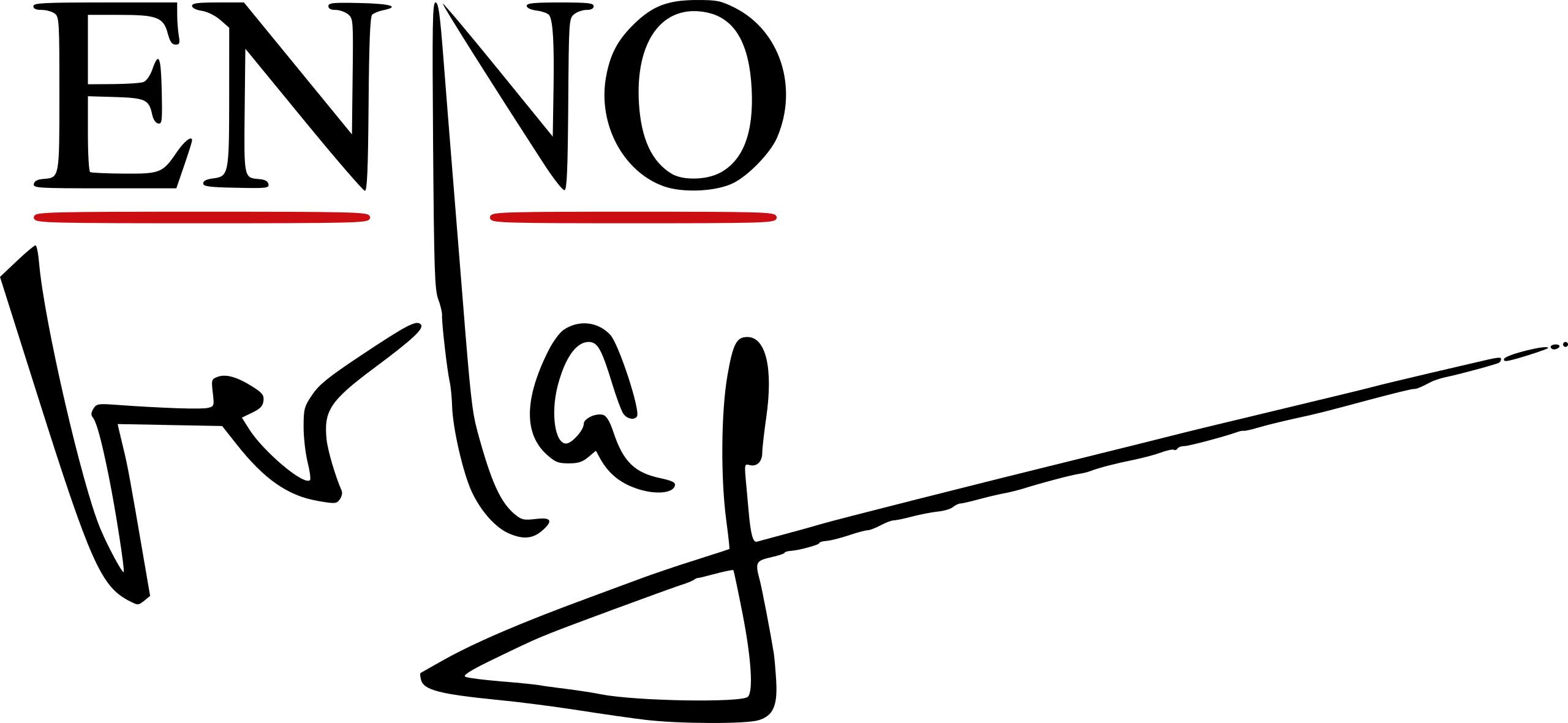Guck nicht so gelangweilt, Hanni! Jedes Leben, sagt man, sei es wert, für die Nachwelt aufgehoben zu werden. In jedem Menschen steckt der Stoff für einen Roman.
Gewebt aus Ödnis, Dummheit und Spucke. Wer will das lesen?
Meine Kinder sollen aus erster Hand erfahren …
… was für ein toller Kerl du warst.
Spar dir die Ironie! Ich möchte ihnen ein bisschen Material an die Hand geben, damit sie mich und meine Zeit verstehen.
Super. Ist dir selber nie gelungen. – Aber bitte, versuch es! Für den Nachruhm zu arbeiten ist ebenso dumm wie zwecklos. Dumm das Arbeiten, zwecklos der Nachruhm. Die Denkmäler Goethe oder Einstein mögen noch eine Weile stehen – aber was haben die beiden davon? Sie sind tot. Die Herren Benz und Daimler ebenso. An Watt und Ohm erinnert sich kaum noch ein Mensch.
Immerhin sind ihre Namen Maßeinheiten geworden, auf ewig verbunden mit Leistung und Widerstand.
Beides bei dir Fehlanzeige.
Bei dir doch auch.
Die Tücken einer Autobiografie sind dir hoffentlich bewusst?
Ich werde nichts verschweigen, nichts beschönigen.
Natürlich nicht. Ich werde mir erlauben, dich daran zu erinnern. – Ginge es nach mir, dürfte überhaupt keine Autobiografie erscheinen, ohne dass eine Gegendarstellung veröffentlicht würde, verfasst vom Umfeld des Selbstdarstellers. Deine gefährlichste Kritikerin, vermute ich, wäre deine Frau?
Isolde? Nein, mein härtester Widersacher war immer ich selber.
Aufregend. – Ich mach dir einen Vorschlag. Wir ergänzen deinen Sermon durch ein paar Storys, die deine Frau ihrem Psychiater zum Besten gibt.
Woher willst du wissen, was sie ihm erzählt?
Keine dummen Fragen, bitte! Literatur lebt von überraschenden Wendungen.
Sie hat überhaupt keinen Psychiater!
Dann bekommt sie jetzt einen. In Büchern ist praktisch alles möglich: So wie du den Schriftsteller spielst, schicke ich deine Frau in die Sprechstunde.
Und ich erfahre, was sich dort abspielt?
Natürlich nicht. Ärztliche Schweigepflicht. Ich schreib’s auf, nicht für dich, nur für deine Kinder.
Isolde hält Psychiater für Scharlatane, die gelangweilten Hausfrauen einreden, ihre Problemchen verlangten nach therapeutischen Sitzungen ohne Ende. Niemals würde sie so einen Vogel aufsuchen.
Vielleicht tut sie es deinetwegen.
Quatsch.
Sie macht sich Sorgen um dein Gemüt.
So, so. Denkst du oder weißt du?
Ich denke, ich weiß mehr über sie als du.
»Oh, Isolde! Was verschafft mir die Ehre? Hat Igor wieder was angestellt?«
Dr. Wolfgang Liesegang schwant nichts Gutes. Der letzte Besuch der Klassenlehrerin seines Sohnes lag Monate zurück. Es war eine Begegnung der besonderen Art. Seitdem schien es, als sei der Vorsitzende des Elternaktivs Luft für Isolde Menne; sie hatte ihn nicht mehr angerufen, auch nicht zur Elternversammlung geladen, kurz vor dem Abitur normalerweise ein Pflichttermin. Aber was war noch normal in diesen Zeiten?
Isolde hat Glück, ihn noch in der Praxis anzutreffen, die Sprechstunde ist lange vorbei. Der Arzt führt sie durch das Wartezimmer. Es ist noch das gleiche, stellt sie fest, neu sind lediglich ein paar Bilder an der Wand, gezeichnete Arztwitze, gemalt von einem Karikaturisten, einem seiner Patienten. Sieht ein bisschen billig aus, denkt sie. Vor einem gerahmten, auf roten Karton aufgezogenen Zeitungsausschnitt bleibt er stehen, stolz, als habe er den Text selbst verfasst:
»In den psychiatrischen Anstalten der DDR saßen natürlich auch wirklich Verrückte. Sie hielten sich für Napoleon, Adenauer oder Mitterrand. Oder sogar für den Kaiser von China. Aber nicht einer von ihnen hielt sich für Ulbricht, Honecker oder Mielke. So verrückt waren sie nun auch wieder nicht.«
Isolde lächelt. Ein Mutausbruch, wie er jetzt allenthalben zu beobachten ist. Das hätte er mal früher aufhängen sollen, vor der Wende! Ein unbilliger Gedanke, weiß sie. Wäre in der DDR niemals gedruckt, vielleicht nicht einmal gedacht worden.
Im Sprechzimmer weist er ihr wieder den Stuhl vor dem Schreibtisch zu. Sofort lebt die Erinnerung auf, auch bei ihm.
»Mich plagt das schlechte Gewissen, wenn ich an deinen Besuch im vorigen Jahr denke. Ich habe mich unmöglich benommen, es tut mir leid, Isolde.«
»Mir nicht.« Frech lächelt sie seine Bedenken weg.
Hat sie etwa eine Wiederholung im Sinn? Verunsichert wechselt der Arzt das Thema: »Warte, ich glaube, ich ahne den Grund deines Kommens.«
»Ich bin gespannt.«
»Igor hat mir erzählt, dass dein Jonas auch Pharmazie studieren will. Und jetzt möchtest du von mir hören, ob das eine Zukunft hat. Die Apotheken im Osten sind längst privatisiert, wenn sie die Hochschule verlassen, der große Kuchen ist verteilt.«
»Das ist Jonas’ Sache, nicht meine. Auf mich hört er schon lange nicht mehr.«
»Jetzt musst du mir helfen. Was führt dich zu mir?«
»Vielleicht das Naheliegende: psychische Probleme.«
Der Doktor runzelt die Stirn: »Psychische Probleme?« Er klingt erstaunt, als sei seine Praxis dafür der falsche Ort. Was er meint: Isolde ist nicht die Frau, von der er einen psychischen Knacks erwartet hätte.
Sie war wegen Martin gekommen, wollte sich Rat holen, wie man einen Menschen erreicht, der sich abkapselt, der unterzugehen droht in dieser gewandelten Welt. Ist er überhaupt zu retten? In Zeiten, da jeder zuerst an sich selber denken muss, erweist er sich als schwach, kämpft nicht, lässt sich schon vom ersten Sturm knicken.
Wolfgang Liesegang hingegen – er hat es wohl geschafft, die Poliklinik liegt hinter ihm, er ist nun niedergelassener Arzt, Existenz gesichert. Selbstbewusst (wenn nicht selbstgefällig) thront er hinter dem Schreibtisch, so sieht es Isolde. Welch Unterschied zu ihrer letzten Visite, als er sich ihrer Vorhaltungen erwehren musste. Sie denkt gern daran zurück, es hilft, die Sorgen um ihren Mann wegzuschieben. Martin gerät schnell in den Hintergrund, eine wohlige Stimmung, befeuert von Erinnerungen, greift Platz. Unversehens reitet sie der Teufel:
»Mein Wunsch ist es, von dir einfach mal wie eine gewöhnliche Patientin behandelt zu werden«, erklärt sie. »Auf der berühmten Couch zu liegen und in die eigenen Abgründe zu tauchen, das stelle ich mir spannend vor.«
Sie glaubt nicht, dass er in der Lage ist, ihr auf den Grund der Seele zu blicken; im Ernstfall hat sie noch jedem Mann etwas vorflunkern können.
Liesegang vermutet, dass sie anderes im Sinn hat als ein Psycho-Spielchen. »Nur um das klarzustellen: Du bist nicht gekommen, weil du mit dem Ende der DDR nicht fertig wirst? Weil dich Ängste plagen, was die Zukunft betrifft?«, fragt er.
Sie muss nicht antworten, lächelnd schaut sie ihm in die braunen Augen: Sehe ich aus, als hätte ich Angst?
»Könnte ja sein, dass du dir was vorzuwerfen hast. Mitgemacht haben wir doch alle irgendwie, mehr oder weniger. Meist mit gutem Gewissen. Jedenfalls am Anfang …« Sie schließt die Augen. Fühlt sich nicht angesprochen. Für einen kurzen Moment blitzt der Gedanke auf, der Doktor selber könnte eine Leiche im Keller haben. Vielleicht sollte sie die Analyse übernehmen …
Liesegang hat sich viel anhören müssen in letzter Zeit. Er weiß, wie er Brücken über Abgründe bauen kann: »Natürlich hast du keinem geschadet.«
Isolde schüttelt den Kopf: »Ich bin einfach nur neugierig, wie einer wie du mit schwierigen Fällen umgeht.«
»Du bist ein schwieriger Fall?«
Die sogenannte Couch ist eine Liege und so gut wie unbenutzt, ein Utensil, das zur Einrichtung gehört, obwohl es keiner braucht. Die Anamnese, die Isolde im Sinn hat, scheint ihn jedoch zu reizen. Aus einem Schrank kramt er ein schlecht gebügeltes, leidlich weißes Laken hervor, das er über die Beichtstatt breitet, sucht eine Weile nach einem Kissen und einer Nackenrolle. Man sieht, zu seinen täglichen Verrichtungen gehört diese Übung nicht. Schließlich bittet er Isolde mit ausladender, fast feierlicher Geste auf das Lager. Das gefällt ihr. Lockerheit mahnt er an, rät ihr, ein paar Blusenknöpfe zu öffnen und die Gürtelschlaufe zu lösen.
Isolde bezweifelt, dass weniger körperliche Einengung ihren Redefluss befördern werde, kommt aber seinem Wunsch gern nach. Sie ist bereit, sich dem Mystischen hinzugeben. Er sitzt am Kopfende hinter ihr, sie kann ihn nicht sehen, weiß nicht, ob er einen Schreibblock auf den Knien hält. Er riecht ein bisschen nach Schweiß, nicht unangenehm, wahrscheinlich unvermeidlich nach der langen Sprechstunde.
Über der Couch entdeckt sie einen Spiralnebel, in pastellenen Tönen an die Decke gemalt, die hellen, von wabernden Schwaden durchzogenen Farben am Rand werden zum Zentrum hin immer dunkler und münden schließlich in einem tiefschwarzen Loch. Über den Sinngehalt der Malerei nachzudenken bleibt ihr keine Zeit.
»Ich schlage vor, wir lassen den Kinderkram weg«, sagt er, »den Frust darüber, dass die kleine Schwester Mutters Liebling war, die Sehnsucht nach dem Vater, der im Krieg geblieben ist, auch den anderen pubertären Mumpitz. Also ohne Umschweife: Was bedrückt dich heute?«
»Eigentlich nichts.«
Die Stille, die daraufhin eintritt, lässt sie vermuten, dass der Doktor mit ihrer Antwort nicht zufrieden ist. Schnell schiebt sie nach: »Höchstens mein Mann. Er ist im Moment in einer kritischen Verfassung.«
»Gut, darüber reden wir gleich. Erzähl mir, wie du ihn kennengelernt hast.«
Oha, Vorsicht! Warum will er das wissen?, fragt sich Isolde. Was hat das mit Martins Zustand zu tun? Ist er nur neugierig, oder führt er was im Schilde?
Wie auch immer – sie lässt sich auf das Spiel ein, kramt in ihren Erinerungen.
Er war mir auf dem Bahnhof in Leipzig aufgefallen. Ein kantiges, sehr männliches Gesicht, breite Schultern, stoppliges kurzes Haar, Bürste genannt, war damals Mode, ein sportlicher Typ, und vor allem ein angemessen großer Kerl, das kam nicht allzu häufig vor. Für mich musste ein Mann mindestens einsfünfundachtzig sein, damit ich mit hohen Absätzen nicht plötzlich einen an meiner Seite hatte, dem ich auf den Kopf spucken konnte.
Eine billige Reisetasche in der Hand, schlenderte er den Bahnsteig entlang, von einem Ende zum anderen und wieder zurück, musterte die lange Reihe der Wartenden. Ein Tiger auf der Jagd, musste ich denken. Er hatte mich bemerkt, ich spürte es, und es tat mir gut. Als sich unsere Blicke trafen, wich er schnell aus. Offenbar war er schüchtern, ich fand das sympathisch. Von den allzu selbstgewissen, abgebrühten Kerlen hatte ich die Nase voll. Als die Einfahrt des Zuges angekündigt wurde, stellte er seine Tasche ab, nur wenige Schritte von mir entfernt. Zufall? Ich schaute zu ihm hin, er wandte sich ab, fühlte sich wohl ertappt. Freundliche braune Augen hatte er. Er gefiel mir.
Nein, nicht schon wieder!, sagte ich mir. Gerade war ich ausgezogen. Mein Koffer, könnte er ihn inspizieren, würde ihn zu dem falschen Schluss verleiten, ich sei ein liederliches Weib. Wild lag alles durcheinander, Cremedosen, Zahnbürsten, Flacons, Lippenstifte, planlos hineingeworden, zerknittert die Blusen und Röcke, staubige Schuhe inmitten der Dessous. Besinnungslos hatte ich meine Sachen aus dem Schrank und den Schubläden gegriffen und in den Koffer geknüllt. Es war aus. Mein Freund und Kommilitone, Liebhaber und starker Arm in Stunden studentischer Verzagtheit, hatte sich als treuloses Schwein erwiesen.
Ich hatte eine Ahnung gehabt, als Frau fühlt man so etwas. Vierzehn Monate waren wir zusammen, hatten uns erst im letzten Studienjahr gefunden, galten aber bald als Traumpaar, Latsch und Bommel, wie man sagte, unzertrennlich. In der Tat habe ich in dieser Zeit allen Verlockungen widerstanden, standhaft wie nie zuvor. Freunde wetteten schon, was zuerst kommen würde, die Hochzeit oder das Kind. Es kam etwas anderes. Unter der Glocke der Hochschule behütet und stets unter Kontrolle, warf ihn im Freiland die erste Sturmbö um. Die Anfechtung war rotblond und fett, unfassbar! Ich musste kein Wort sagen. Als ich in der Tür stand, klaubte sie ihre Sachen zusammen und verschwand.
Sie aus seiner Wohnung zu vertreiben war leicht, unmöglich hingegen, sie aus dem Kopf zu kriegen. Seine Entschuldigung, seine Erklärungsversuche erreichten mich nicht, ich hielt mir die Ohren zu. Mir war, als sei ich von Anfang an hintergangen, um ein Jahr meines Lebens betrogen worden. Streichen, das Kapitel, befahl ich mir, vergessen, den Kerl! Ich verlangte Unmögliches, das wusste ich, und ärgerte mich, dass ich den Schalter nicht einfach umlegen konnte. Er war geblieben, dieser blöde Schmerz.
Und nun, verletzt auf der Flucht, lief mir dieser Mensch über den Weg! War das ein Zeichen? Mit Sicherheit kein dominanter Pascha, wie mir schien. Ich drehte mich nach ihm um. Diesmal hielt er meinem Blick stand, gute zwei Sekunden, schätzte ich, mit ernstem Gesicht. Ich lächelte, aber nur innerlich. Plötzlich kitzelte mich die Abenteuerlust. Einen Versuch wäre er wert, dachte ich. Dass es mir keinen Spaß machen würde, lange allein zu sein, wusste ich, nicht in dieser bewegten Zeit, da so vieles auf mich zukam: die erste Arbeitsstelle, neue Kollegen und möglicherweise widerborstige Schüler. Mir fiel ein, was meine flotte Studienfreundin Jutta immer gesagt hatte, wenn eine ihrer Liebschaften in die Brüche gegangen war: Nicht Trübsal blasen! Gegen Männer helfen nur Männer!
Als der Zug in den Bahnhof rollte, raffte ich allen Mut zusammen, ging zu ihm hin und fragte, ob er mir vielleicht beim Einsteigen mit dem schweren Koffer behilflich sein könnte. Ich hatte so etwas noch nie gemacht, entsprechend verkrampft wird mein Lächeln ausgefallen sein. Ich erwartete nicht viel, jedenfalls nichts Ernsthaftes, nur ein bisschen Unterhaltung für die zwei Stunden bis Dresden. Mich von meinem Kummer abzulenken, dafür schien mir der Junge gut zu sein.
Der arme Kerl war vollkommen perplex und außerstande, auch nur ein einziges Wort zu sagen. Er nickte nur, nahm meinen Koffer und folgte mir. Nachdem er mein Gepäck in die Ablage gewuchtet hatte, stand er einen Moment unschlüssig im Abteil, als wisse er nicht, ob er nun gehen sollte oder nicht. Ich deutete auf die Sitzbank und setzte mich ihm gegenüber. Er war noch unsicherer, als ich vermutet hatte. Vor Aufregung traten ihm Schweißperlen auf die Stirn. Rührend. Er schaute mich nicht an, sondern suchte die Gesichter der anderen Fahrgäste ab, wonach, wusste ich nicht. Wahrscheinlich fürchtete er, sie könnten seine prekäre Situation erkennen.
Um ihm aus seiner Verlegenheit zu helfen, spielte ich Normalität. Gemeinsam eingestiegen, gemeinsam Platz genommen, wir waren ein Paar, jedenfalls für die Mitreisenden. Also fragte ich ihn so gleichmütig, wie es mir möglich war:
»Wollen wir auf den Gang gehen, eine rauchen?«
Ergeben trottete er hinter mir her. Ich hätte mir die Zigarette auch drin anzünden können, zufällig waren wir in einem Raucherabteil gelandet, vielleicht hatte ich es unbewusst angesteuert.
»Müssen ja nicht alle hören, was wir reden«, sagte ich draußen und lächelte ihn an. So konnte er sich als Teil einer Verschwörung fühlen, deren Sinn ihm, aber auch mir noch verborgen war.
Das Angebot, eine mitzurauchen, lehnte er kopfschüttelnd ab, sein Gesicht ließ keinen Zweifel: Widerwärtig, die Qualmerei! Trotzdem nahm er mir, wie er es wahrscheinlich bei eleganten Herren im Film gesehen hatte, die Streichhölzer aus der Hand und gab mir Feuer. Ich nutzte die Gelegenheit und kam ihm ganz nahe, ergriff seine Hand, als müsste ich ihm helfen, das brennende Holz behutsam zum Ziel zu führen. Tatsächlich zitterte er ein wenig. Er hatte schöne Hände, registrierte ich, lange, schmale Finger.
Ihm wurde immer heißer, der Schweiß begann zu rinnen. Mit einem kurzen Ruck öffnete ich das Schiebefenster einen Spalt, damit er sein Gesicht in den Fahrtwind halten konnte.
»Studieren Sie in Leipzig?«, fragte ich.
»Nein, ich habe einen Schulfreund besucht.« O verdammt!, dachte ich. Er hatte eine tiefe, dunkle Stimme, und ich war anfällig für diesen sonoren Sound. »Gestern waren wir in der Kongresshalle zu einem Jazzkonzert. Rolf Kühn, Klarinette, falls Ihnen der Name was sagt.«
»Ja klar, den kenne ich vom Jazzfestival in Dresden. Günter Hörig und die Dresdner Tanzsinfoniker, falls Ihnen die was sagen.«
»Schon mal gehört, ja.«
»Und wie hat’s Ihnen gefallen?«
»Sehr gut.« Mehr konnte er nicht sagen. »Ich war zum ersten Mal beim Jazz.«
»Sie sind Student, stimmt’s?«
»Ja, in Kürze drittes Studienjahr, Elektrotechnik an der TH Dresden.«
»Elektrotechnik? Das trifft sich gut, bei mir muss eine Glühbirne ausgewechselt werden. – Nein, Unsinn! Blöder Witz.«
Ich musste aufpassen. Das klang ja wie eine Einladung. Beherrsch dich, Isolde, er bekommt ein falsches Bild von dir! Für solche Scherze schien er nicht gemacht zu sein.
»Stammen Sie aus Dresden?«, fragte ich.
Er nickte.
»Und wohnen noch bei Ihren Eltern?«
Er nickte wieder. War ihm offensichtlich unangenehm.
Schnell eine Fangfrage hinterher: »Erwartet Sie jemand am Bahnhof?«
»Nee«, antwortete er brav.
Ein bisschen unbedarft, der Junge. Eingeschüchtert kam er mir vor. Waren meine Fragen zu aufdringlich? Ich musste ihn auflockern.
»Finden Sie die Siezerei nicht auch komisch? Ich schlage vor, wir sagen Du, einverstanden?« Ohne seine Antwort abzuwarten, stellte ich mich vor: »Ich heiße Isolde. Leider. Kann nichts dafür.«
»Schöner Name«, log er. »Ich bin Martin. Da stecken Max und Martha drin, so heißen meine Eltern.«
»Martin gefällt mir«, sagte ich und sah ihn groß an. Er sollte durchaus merken, dass meine Bemerkung nicht nur seinem Namen galt. Einen Martin hatte ich noch nicht in meiner Sammlung.
Er reagierte nicht. Begriffsstutzig oder verklemmt. Oder beides, ich war mir nicht sicher.
Kein Interesse seinerseits, so schien es mir, das Gespräch drohte zu verebben. Also musste ich seinen Part übernehmen und mich mit Fragen bedrängen, die zu stellen er sich nicht traute.
»Du bist bestimmt neugierig, was ich so treibe, hab ich recht?«
Hatte er genickt? Egal, ich machte einfach weiter. »Mein Leben in Kurzfassung: Geboren und aufgewachsen in Wilthen, Oberlausitz, kennst du vielleicht, da wo die Goldkrone und der Edel gebrannt werden. Bis zum Abitur jeden Tag von Wilthen mit der Bahn nach Bautzen zur Oberschule, dann, weil mir nichts Besseres einfiel, Pädagogische Hochschule Potsdam, in diesem Sommer fertig geworden, noch eine Woche, dann geht’s los, rate mal, wo? – In Dresden, komisch, was? Lehrerin für Biologie und Chemie, ’ne kleine Wohnung haben sie mir schon besorgt, bisschen primitiv, Hinterhof, halb in der Erde vergraben, Souterrain nennt sich das, klingt vornehmer. Aber ich will nicht meckern.«
Er hörte sich alles an, nicht uninteressiert, wie es schien, hakte aber nicht nach, ging auch mit keiner Frage dazwischen, nach meinen Freizeitinteressen zum Beispiel oder warum in meiner Erzählung kein Mann vorkam. So kühn war er nicht. Diskret, dieser Martin, grundsolide bis zur Langweiligkeit. Meine Neugier begann zu lahmen.
Das Bild änderte sich, als ich mich nach seinen Hobbys erkundigte. Er war zu träge im Kopf (oder zu ehrlich), um mich zu beeindrucken mit Musik, Theater, Kunst. Oder mir etwas Tolles vorzuflunkern, Tanzen vielleicht. Stattdessen war ihm nichts anderes eingefallen als die Wahrheit.
»Klettern in der Sächsischen Schweiz!«, raunte er mir zu, als verriete er mir ein streng gehütetes Geheimnis.
Na, danke! Kalte, graue Felsen bot er mir an, welch Lustgewinn! Mein Kommentar fiel entsprechend aus. »Oh toll, klettern!«, sagte ich. »Das würde ich auch gern!«
Ein unbedachter, dummer Satz mit verblüffender Wirkung.
»Wie bitte? Hab ich richtig gehört?« Er lebte auf. Hatte die Ironie nicht verstanden. »Ein Mädchen, das klettern möchte, ist mir noch nie begegnet. Ich dachte immer, Klettern ist eine Sache für Männer. Aber warum nicht?!«
Fortan kam ich kaum noch zu Wort. Er war in seinem Eifer kaum zu bremsen, überhäufte mich mit Namen von Felsen, die für den Anfang gut geeignet wären, der eine leicht zu besteigen, der andere mit wunderbarer Aussicht, schwärmte von verschwiegenen Gipfeln in den Schrammsteinen, von reizvollen Wegen im Bielatal, auch im Rathener Gebiet …
Er hatte ja doch Feuer, der Mann. Mit einem Mal sah er mich mit anderen Augen an. Bis dahin hatte er, wie alle Männer, heimlich nach meinen Brüsten geschielt, das störte mich wenig, der Busen war meine schwache Stelle nicht, nun aber vermaß er mich ganz unverhohlen von oben bis unten und gab halblaut die Ergebnisse bekannt: gute Hebel, die Griffhöhe ordentlich, Gewicht im Notfall beherrschbar, Muskulatur vermutlich mäßig, aber ausbaufähig. Er prüfte mich auf meine Tauglichkeit am Fels! Scheute sich nicht, meine Oberarme zu packen, um dem Bizeps auf den Zahn zu fühlen, wie er sagte.
Es machte ihm offensichtlich Spaß, und, ehrlich gesagt, mir auch. Er wurde immer lockerer, fing an Witze zu machen, bald plauderten wir über dies und das, nicht nur über das Bergsteigen. Mensch Martin, staunte ich, du bist ja doch eine Option!
Mir war klar, ließe ich mich von ihm ins Kletterseil einbinden, hätte ich ihn an der Leine. Wollte ich das?
Der Zug näherte sich Dresden. Noch immer standen wir im Gang und quasselten, ohne Luft zu holen. Ich wusste, dass sich unsere Wege bald trennen würden und noch einiges zu bereden war. Denn ich hatte einen Plan gefasst, einen verwegenen Plan. Den musste ich an den Mann bringen, in aller Vorsicht, weil schwer abzusehen war, wie mein aufgedrehter Kletter-Martin reagieren würde.
Ich holte weit aus, erklärte ihm zuerst, dass ich heute nicht in Dresden-Neustadt aussteigen, sondern bis Bautzen durchfahren würde. Ich müsste meine Mutter besuchen, das hätte ich versprochen.
»So ein Problem kennst du nicht. Du kommst jeden Tag brav nach Hause zu Mutti. – Gefällt dir das eigentlich? Oder willst du nicht langsam mal ausziehen?«
»Wie denn? Als Dresdner hast du keinen Anspruch auf eine Studentenbude.«
»Du kannst ja behutsam anfangen, erst mal nur eine Nacht wegbleiben und sehen, wie Mama es verdaut.«
Verdattert starrte er mich an. Sicherlich hatte er mich falsch verstanden, ich konnte aber nicht viel erklären, es ging alles sehr schnell, der Zug war schon kurz vor dem Bahnhof, höchste Zeit für mich, nun ebenfalls in die Zielgerade einzubiegen.
»Ich hätte da eine Idee«, sagte ich. »Du könntest mir meinen schweren Koffer abnehmen und zu mir in die Wohnung tragen, für den Abstecher zu meiner Mutter habe ich alles Nötige in der Reisetasche. – Alaunstraße, kennst du vielleicht, keine Viertelstunde zu Fuß. Würdest du das tun für mich?«
»Aber meine Eltern …« Es ging ihm offensichtlich zu schnell. Der Zug bremste, die Leute drängten auf den Gang.
»Pass auf«, sagte ich, »hier der Hausschlüssel – klar? Im Innenhof das linke Quergebäude. Links, klar? Souterrain, da gehen vier Stufen hinunter. Das ist der Wohnungsschlüssel. Du kannst dort schlafen. Im Kühlschrank findest du genug. Spätestens morgen Mittag bin ich zurück und befreie dich. Ich lade dich zum Essen ein, danach kriegst du den Laufpass zu Mutti.«
Zu überrascht, um Widerstand zu leisten, zerrte er meinen Koffer aus dem Gepäcknetz, vergaß fast seine eigene Tasche. Ich schob ihn, die Hände auf seinen knochigen Hüften, vor mir her zur Tür. Er war der Letzte, der ausstieg. Zuvor zog ich ihn an mich, umarmte ihn fest, ein angenehmes Gefühl, warm, er hatte nur ein dünnes Hemd, ich mein Sommerkleidchen an. Dann löste ich mich und drückte ihm einen flüchtigen Kuss auf die Lippen. Er lächelte. Hatte sich also durchgerungen. »Danke«, flüsterte ich. »Ich freue mich. Das Bett ist frisch bezogen. Unterm Kopfkissen findest du mein Negligé, leg’s beiseite, es passt dir sowieso nicht.«
Martin stellte das Gepäck auf den Bahnsteig und winkte, bis mein Zug hinter einer Kurve verschwand. Ich sah noch, wie er sich mit den Fingern, den schönen langen Fingern, über die Lippen strich, offenbar dem Kuss nachspürte. Gewiss, ich hatte ihn überrumpelt, war aber sicher, er würde es nicht bereuen. Ein lieber Kerl, gut zu führen, dachte ich.
»Genug für heute! Erste Sitzung beendet«, sagt der Doktor.
Was soll das? Isolde ist ernüchtert. Das nannte sich Psychologie? Wozu sollte so etwas gut sein? Von ihm war gar nichts gekommen, keine Frage, auch keine Berührung, nicht mal seine Hand auf ihrem Arm oder ein sanftes Streicheln über Stirn und Wangen. Sie hatte sich mit anderen Erwartungen auf die Couch gelegt. Jetzt ahnt sie: Es war falsch, die Patientin zu spielen. Bestimmt hat ihm sein Berufsethos dazwischengefunkt, jener ärztliche Anstand, der bei ihrem ersten Besuch so vollkommen deaktiviert gewesen ist.