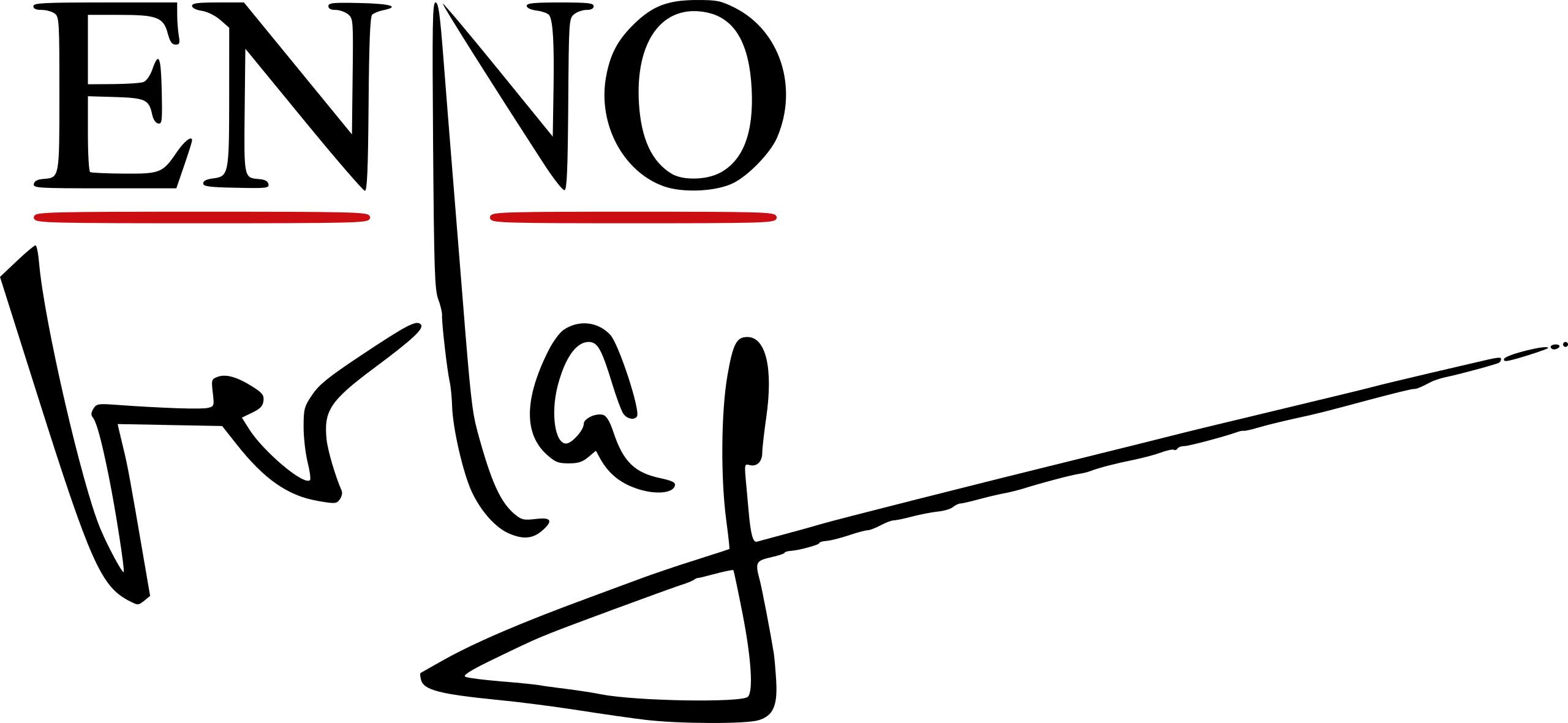Hast du dir mal ausgemalt, wie es wäre, wenn dein Manuskript einen Verleger fände, der es tatsächlich drucken würde?
Das male ich mir ständig aus, jede Nacht.
Und wenn das Buch dann einen Preis bekäme?
Ich kann mir manches vorstellen – das nicht.
Wieso? Wenn in Deutschland etwas publiziert wird, folgt die Auszeichnung fast automatisch.
Die holen doch keinen Anonymus auf die Bühne! Oder soll dann eine Hostess ein leeres Sakko hereintragen, dem sie die Medaille anheften?
Hauptsache, es hat genug Taschen für das Preisgeld.
Preisgeld?
Es gibt fast immer was, vier- bis fünfstellig. Und der Laureat muss dafür eine Rede reden.
Eine Rede? Was soll man da sagen? Danke! Mehr fiele mir nicht ein.
Dass dir nichts einfällt, ist ja nichts Neues. Erwartet wird eine launige kleine Ansprache, möglichst eine Spur selbstironisch, das kommt immer an.
Liegt mir nicht.
Weiß ich. Ich hab dir für den Fall der Fälle was aufgeschrieben.
Warum? Soll ich etwa deinen Text aufsagen?
Keine Angst, niemand wird der Dankesrede anmerken, dass sie nicht von dir stammt. Sie werden dich als tollen Hecht feiern und gar nicht auf die Idee kommen, dass hinter dir ein origineller Kopf steckt, und schon gar nicht, dass die Auszeichnung eigentlich dem Ghostwriter zusteht, also mir. – Hier ist die Rede, du kannst schon mal üben, sie vorzutragen, mit Betonung, bitte.
Liebe Genossinnen und Genossen!
Oh, Entschuldigung! Falsche Veranstaltung. Ich komme halt aus anderen Verhältnissen, wissen Sie vielleicht. Harte Zeiten. Ich will mich verbessern:
Meine sehr verehrten Damen …
Nein, auch falsch! Nicht »meine« … Ich darf nicht Besitz anzeigen, wenn ich dem Finanzamt hartnäckig das Gegenteil melde. Letzter Versuch:
Sehr verehrte Damen, geehrte Herren!
Ja, jetzt haben wir’s. – Gleich zu Beginn muss ich Sie um Nachsicht bitten. Auch ein sogenannter freier Schriftsteller ist nicht unbedingt zur freien Rede begabt. In meinem Falle heißt das: Frank und frei kann ich nur sprechen, wenn ich ein Blatt vor dem Mund hab. (Wedelt mit dem Manuskript.)
Hier steht: Ich bin gerührt! Mit Ausrufezeichen. Kommt mir übertrieben vor. Aber weiter im Text: Dieser Preis, nein, kaum zu glauben! Ich bin gerührt. Auch wenn Sie es mir nicht ansehen. Im Alter versiegt ja vieles, die Älteren unter Ihnen wissen Bescheid. Unter anderem versiegt die Produktion der Tränendrüsen. Glauben Sie mir: Wenn ich könnte, würde ich jetzt heulen, so gerührt bin ich.
Es ist ein bitter-süßes Glück, das mich mit dieser Ehrung streift, denn es erreicht mich spät, sehr spät. Denke ich nur, wie mir früher, in der Maienblüte der Jugend, die Herzen zugeflogen wären! Wie stolz der umschwärmte Dichter sein blondgelocktes Haupt getragen hätte! Heute indes, meine Damen, verheißt es nur mäßiges Entzücken, mich zur Brust zu nehmen. So sehr Sie auch drückten, es käme wenig Ersprießliches heraus, Tränen leider gar nicht. Es ist mir nicht mehr gegeben, Ihr liebreizendes Antlitz, Ihren schwellenden Busen mit heißen Zähren zu netzen, wie ich es früher, in der golden gleißenden Sonne meines Lenzes, voller Hingebung getan hätte. Ach!
Steht hier: Ach! Ein gehobener Text war gewünscht. Ach!, so stöhnt die Hochliteratur, wenn schmerzliche Entsagung den Sturm der Gefühle ins Innere bannt. Kennen Sie vermutlich aus Ihrer Bettlektüre: Ach!
Ich bin Ihnen, glaube ich, eine Erklärung schuldig. Wie Sie sicher wissen, wollte ich anonym bleiben. Normalerweise scheue ich die Öffentlichkeit, meine Person sollte hinter meinem Werk austreten. Wegtreten. Zurücktreten. Aber dieser Preis hier warf den guten Vorsatz über den Haufen. Wie hätte ich anders reagieren können? Läuft eine solche Ehre auf mich zu und winkt auch noch mit Geld, bin ich unwiderstehlich. Ich meine, dann bricht das den Widerstand. Beziehungsweise: werde ich weich – ja, so ist es richtig. Ich bin flexibler, als man denkt. Mal stehe ich wider, mal nicht.
Sie merken wahrscheinlich, die Wörter bereiten mir zunehmend Probleme. Deshalb bin ich Schriftsteller geworden. Nein, kleiner Scherz. Wahr ist, dass ich mich glücklich schätze, mein Werk gerade noch rechtzeitig vollendet zu haben. Die Phase zwischen unartikuliertem Babygebrabbel und prämortaler Wortfindungsstörung ist ja nicht lang. Sie vergeht wie im Fluge, besonders wenn man sein Opus magnum so lange vor sich her schiebt. Nicht dass ich faul gewesen wäre! Ich faule auch heute noch nicht. Aber plötzlich drängte sich mir ein Gedanke auf, den ich in einen wundervollen Satz gegossen habe wie in Bronze, er lautet: Kinder, wie die Zeit vergeht! Niemand vor mir, glaube ich, hat die Vergänglichkeit jemals so suggestiv auf den Punkt gebracht. Kinder, wie die Zeit vergeht! Das wird bleiben. Ein verbales Denkmal meiner Kreativität.
Ja, die Zeit rast. Ich nicht. Ich raste nie. Denn wie heißt es? Wer rastet, der rostet. Ich möchte nicht Rost ansetzen, auch nicht Grünspan.
Oder Schimmel. Himmel!
Sie sehen, ich bin auch poetisch begabt. Das nur am Rande. Soll ich Ihnen mal mein schönstes Gedicht vortragen? Es hat nur zwei Zeilen:
Jeder endet
unvollendet.
Das hat was, was? Was da drinsteckt!
Um ehrlich zu sein: Ich habe schon gedacht, die haben mich vergessen, die tausend Literaturpreisjurys im Lande, die wissen nicht, wie alt ich bin und dass sie sich beeilen müssen mit der Verleihung. Heute endlich erfüllt sich für mich ein Kindheitswunsch. Ich habe nämlich sehr früh davon geträumt, diese Ehrung (oder eine noch besser dotierte) entgegennehmen zu dürfen. Lange fehlte nur das Buch zum Preis, sonst passte alles. Ich war der ideale Mann für die Auszeichnung, das fühlte ich ganz stark, musste bloß noch meinen Roman schreiben. Die Sehnsucht danach wurde übermächtig. Ich ließ Kinder und Familie verkommen und setzte mich hin, mein Werk zu gebären und ihm den nötigen Schliff beizubringen. Jetzt liegt meine erste Arbeit vor. Nach dreißig Jahren hartnäckigen Nachdenkens. Das unablässige Ringen mit den Wörtern, gepaart mit meiner überbordenden Fantasie, hat zum Ergebnis, dass schon mein Erstling den Geist der großen Geister der Geistesgeschichte atmet. Das Buch versprüht, wie der Laudator es so schön in Worte fasste, den Odem des Vollendeten, ein veritables Spätwerk, reif und abgestanden.
Dabei handelt es sich um eine hanebüchen simple Story. Es passiert nichts Aufregendes. Eine Ehegeschichte, die über die Niederungen des Alltags nicht hinauskommt. Die in Wortmüll verpackte Langeweile schont die Nerven, das ist das einzig Positive, was sich über das Buch sagen lässt. Kein attraktiver Blickwinkel, keine faszinierend neue Sicht auf Altbekanntes, nichts, was beflügeln und inspirieren könnte.
Denken Sie nicht, Damen und Herren, ich wollte durch übermäßiges Herabsetzen meiner künstlerischen Leistung Ihren Widerspruch hervorkitzeln und Komplimente heischen. Ich kenne Leute, die auf solche Weise hoffen, ein Bad vor der Menge nehmen zu können, die Dusche der Eitelkeiten voll aufzudrehen und sich mit Selbstgefallen zu balsamieren. Solches Tun ist mir fremd. Nein, es ist schlicht die Wahrheit, dass ich in dem Buch nur banale Alltäglichkeiten verhandle. Keiner weiß besser als ich, dass ich nichts zu sagen habe.
Das Schöne ist nur: Der Leser vermutet hinter dem aufgepeppten Trödel einen Sinn. So ging es offenbar auch den Juroren. Sie haben sich bei der Analyse viel Mühe gegeben und tolle rezensorische Kapriolen geschlagen. Haben sogar meine einfache Sprache gelobt, ohne zu wissen, dass mir eine andere gar nicht zur Verfügung steht. Deshalb ist es mir ein Herzensbedürfnis, der Jury für ihr außerordentlich kenntnisreiches, durchdachtes, wissenschaftlich wohlbegründetes Urteil zu danken. Ihnen und allen, die mein Werk in ähnlicher Weise zu würdigen verstehen, fühle ich mich verbunden. Herzlichen Dank.
Und wo gibt’s jetzt das Geld?